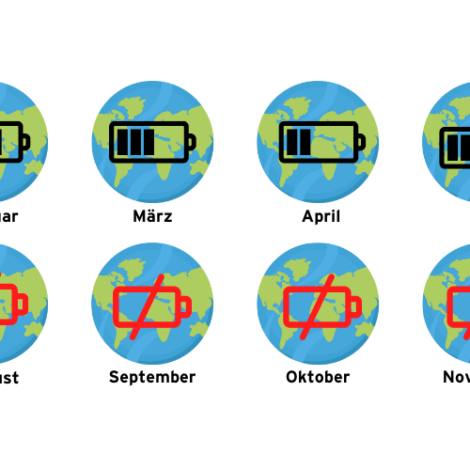Beitrag von unserer Bloggerin Stefanie Reichl
Widerstandsfähigkeit für Umweltschützer & Umweltschützerinnen
Schon seit einiger Zeit scheinen die schlechten Nachrichten kein Ende zu nehmen. Krieg in fast unmittelbarer Nähe, eine scheinbar unaufhaltsame Klimakrise und potentielle Energiekrise.

Es macht keinen Spaß mehr…
Schon seit einiger Zeit scheinen die schlechten Nachrichten kein Ende zu nehmen. Krieg in fast unmittelbarer Nähe, eine scheinbar nicht enden wollende Pandemie und potentielle Energiekrise. Ich halte mich ja eher für den zuversichtlichen Typ, behaupte aber, dass News wie diese selbst bei den hartgesottensten Optimistinnen und Optimisten ein Unbehagen in der Magengegend hervorrufen.
Im Umweltbereich reißen die Negativ-Schlagzeilen ebenfalls nicht ab. Erst vor wenigen Wochen veröffentlichten Forscher*innen eine neue Studie, laut der es ab 2040 zu warm für Permafrostböden sein wird. Im Great Barrier Reef findet aufgrund einer neuen Hitzewelle gerade die sechste große Korallenbleiche seit 1998 statt. Und das globale Artensterben scheint nicht langsamer, sondern immer schneller zu werden.
Und was mache ich? Ich stehe hier, überspitzt formuliert, mit meiner Bambuszahnbürste und den nachhaltigen Second-Hand Klamotten und frage mich langsam, ob das überhaupt alles noch irgendeinen Sinn hat. Oder ob ich einfach aufgeben soll mit dieser ganzen Weltverbesserungs-Schose, weil ich hier offenbar gegen Windmühlen kämpfe. Und ich will nicht lügen: Die ständigen Weltuntergangsszenarien, das Gerede von Kipppunkten und Klimakatastrophen – mir macht das Angst.
I‘m not alone
Was beruhigend ist: Mit diesen Gefühlen der Überforderung und Ohnmacht bin ich scheinbar nicht alleine. Tatsächlich gibt es mittlerweile eigene Begriffe für die Angst um den Planeten („eco anxiety“) und das Gefühl der Trauer, wenn geliebte Orte aus der Natur verloren gehen („solastalgia“). Im deutschsprachigen Raum spricht man auch häufig von Klimaangst. Und diese nimmt zu, wie verschiedene Umfragen zeigen.
So ist in den USA mehr als die Hälfte aller Erwachsenen darüber besorgt, wie der Klimawandel ihre mentale Gesundheit beeinflusst und fast 40 % der amerikanischen Teens und Mitzwanziger sehen den Klimawandel als ihre größte Sorge an. Eine relativ aktuelle Studie der Sigmund-Freud-Uni in Wien kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Bei deren Befragungen gaben sogar etwa 80% an, wegen des Klimawandels besorgt zu sein wären.
Und im Nachbarland Deutschland sagten 2020 ca. 40% der Befragten einer Umfrage an, dass sie vermehrte Angst vor Naturkatastrophen hätten und auch die Menschheit im Allgemeinen bedroht sähen. Umweltaktivistinnen und -aktivisten sind aufgrund der konstanten Nähe zum Thema besonders häufig von Eco Anxiety betroffen. Mittlerweile gibt es sogar eigene mentale Gesundheitsprojekte, wie etwa die NGO „The resilient activist“ die gezielt auf diese Gruppe ausgerichtet sind.
Bleibt die Frage, wie wir mit diesen (nicht gerade angenehmen) Gefühlen am besten umgehen. Was für Möglichkeiten gibt es, um positive Emotionen zu bewahren und nicht die Hoffnung zu verlieren?
Aufgeben ist nicht drinnen
In der Ökologie versteht man unter Resilienz die Fähigkeit eines (Öko-)systems, wichtige Funktionen selbst bei bedrohlichen äußeren Einflüssen aufrecht zu erhalten und adäquat auf Störungen reagieren zu können.
Resilienz gibt es aber auch in der Psychologie, denn Menschen können ebenso widerstandsfähig sein und Methoden finden, mit den negativen Einflüssen von außen besser umzugehen.
Da mich das Thema in letzter Zeit sehr beschäftigt hat, habe ich mir die Zeit genommen ein paar dieser Handlungsmöglichkeiten zu recherchieren. Diese möchte ich gerne mit euch teilen – vielleicht helfen sie ja auch manchen von euch durch diese unsicheren Zeiten.
Die sieben Säulen der Resilienz
Wer nach Resilienz googelt, landet auf jeden Fall bei den 7 Säulen, einem Modell, dass das Konzept Resilienz, wie der Name schon vermuten lässt, in sieben Unterbereiche unterteilt. Je nach Autor*in unterscheiden sich die Säulen dabei immer etwas in den Begriffen, die Kernaussagen sind aber jeweils ziemlich ähnlich.
Ein Punkt, der mir immer wieder untergekommen ist, ist das Thema Akzeptanz. Einerseits von den eigenen (negativen) Gefühlen, andererseits von Zuständen, die wir nicht oder noch nicht beeinflussen können. Damit ist aber nicht gemeint, dass wir einfach alles als gegeben hinnehmen und uns quasi selbst handlungsunfähig machen.
Ziel ist es vielmehr, gegen unabänderliche Tatsachen nicht anzukämpfen, sondern diese anzunehmen und dann von diesem Punkt aus neue Handlungsmöglichkeiten auszuloten. Im Bezug auf den Umweltschutz könnte das beispielsweise heißen, einfach mal zu akzeptieren, dass man den Klimawandel alleine unmöglich aufhalten kann und das eben nicht alles von individuellen (Konsum-)Entscheidungen abhängt.
Das bedeutet aber nicht, dass man nichts zum Umweltschutz beitragen kann oder schlimmer noch, dass es keinen Sinn hätte. Es heißt einfach nur, dass man sich auf jene Dinge konzentriert, die im Moment konkret beeinflussbar sind. Das rät beispielsweise auch der Umweltaktivist Alex Olivera aus Mexico, der sagt: „Ich habe gelernt, nicht das Gewicht gigantischer oder unrealistischer Ziele auf meine Schultern zu laden. […] Wenn ich erschöpft und deprimiert bin, hilft das niemandem.“
Am Beispiel von vorhin gemessen könnte man also beispielsweise an Klimademos teilnehmen, Nachrichten an Politiker*innen schreiben, die Ernährung umstellen oder sich möglichst CO2 frei fortbewegen. Dadurch übernimmt man gleichzeitig Verantwortung und stärkt das Gefühl der Selbstwirksamkeit, ebenfalls zwei Begriffe, die in der Resilienzforschung eine große Rolle spielen.
Ideal ist es, wenn man dabei in Kontakt mit anderen tritt, denn gute, persönliche Beziehungen zu anderen Menschen oder Gruppen sind ebenfalls ein maßgeblicher Faktor um widerstandsfähig zu sein. Das schließt mit ein, dass man auch mal um Hilfe bitten kann, wenn man sie benötigt.
Jetzt wieder im Umweltschutz-Kontext gedacht, kann man sich vielleicht in einer Food-Coop engagieren oder freiwillige Aufgaben bei einer NGO übernehmen, dann schlägt man gleich mehrere (Resilienz-)Fliegen mit einer Klappe.
Eine gesunde Portion Optimismus zeichnet resiliente Menschen übrigens auch aus. Wer daran arbeiten möchte, kann sich zum Beispiel in Dankbarkeit üben oder sich einfach mal ganz bewusst Zeit nehmen, sich auf die positiven Nachrichten zu konzentrieren. Diese gibt es nämlich auch!
Was Alex Olivera zur Stressreduktion übrigens noch empfiehlt, genauso wie ein Haufen Stressforscher*innen und Psycholog*innen mit ihm, ist Aktivität im Freien. Leute, die sich für Umweltschutz interessieren, sind hier meiner Meinung nach klar im Vorteil, da wir ja ohnehin meistens gerne Zeit in der Natur verbringen.
Wer jetzt nicht einfach nur alleine im Wald spazieren geht, sondern vielleicht gemeinsam mit anderen Menschen im Gemeinschaftsgarten werkt, hat ebenfalls wieder einen Haufen der Punkte von oben abgedeckt… Und tut sogar gleichzeitig was für den Umweltschutz.
Wie auch immer – den Kopf in den Sand zu stecken, scheint tatsächlich die schlechteste Alternative zu sein, denn in diesem Fall fühlt man sich weder selbstwirksam noch optimistisch noch eingebunden in irgendeiner Weise. In diesem Sinne: Let‘s fight on (resiliently)!